Der Wandel der Finanzindustrie zeigt sich in wenigen Bereichen so deutlich wie im Zahlungsverkehr. So haben in den vergangenen Jahren sowohl privatwirtschaftliche Initiativen als auch einige Zentralbanken an der Konzeption und Pilotierung von digitalem Geld gearbeitet. Als Folge hat die Europäische Zentralbank (EZB) im Juli 2021 eine zweijährige Evaluationsphase zur Entwicklung eines digitalen Euro angekündigt. In diesem Zusammenhang spielen die Bedarfe kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) sowie kapitalmarktorientierter Unternehmen aus Deutschland als weitere wesentliche Nutzergruppen im Rahmen der Industrie 4.0, des Internet of Things (IoT) sowie der Machine Economy eine maßgebliche Rolle für den Erfolg eines digitalen Euro.
Abgeleitet aus 56 leitfadengestützten Tiefeninterviews ergeben sich für den zukünftigen Zahlungsverkehr die nachfolgenden Handlungsimplikationen für Politik, Zentralbanken und die Kreditwirtschaft zur Förderung der Transformation der europäischen Wirtschaft.
Zum Originalbeitrag in voller Länge
Digitaler Euro – der Weg für Unternehmen in das „Internet of Payments“?
Analyse | 25 Seiten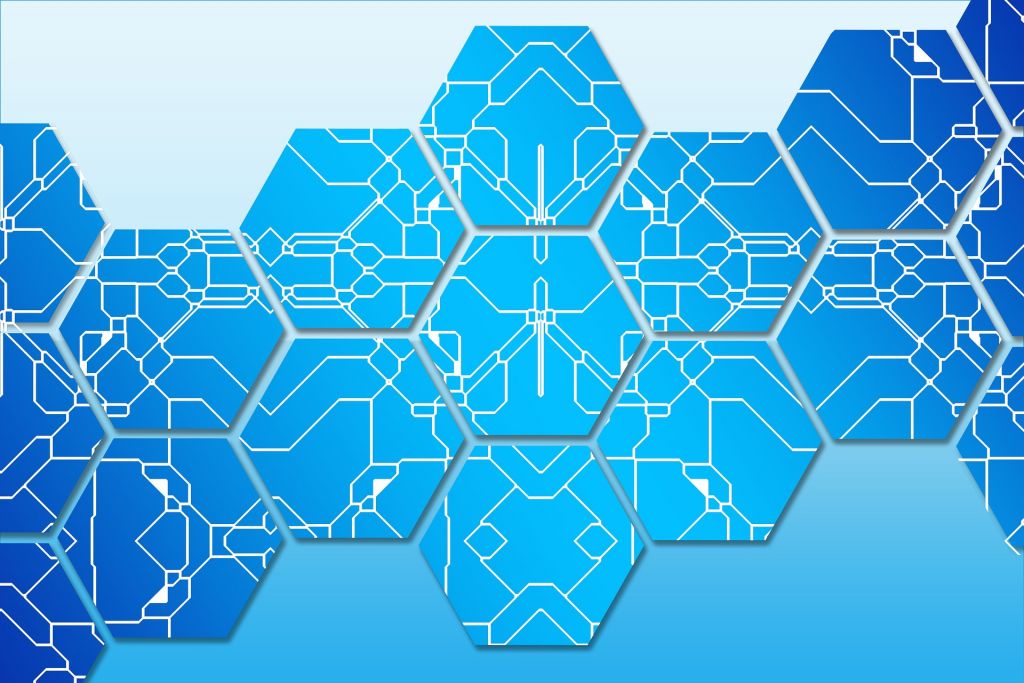
Es besteht Bedarf an einem „Internet of Payments“.
Um zukünftig Zahlungen effizient abwickeln sowie neue, digitale Geschäftsmodelle bei einer wachsenden Anzahl an IoT-Geräten und intelligenten Maschinen realisieren zu können, benötigen Unternehmen ein neues Zahlungsmittelökosystem – „Internet of Payments“.
Für ein „Internet of Payments“ werden digitale Identitäten benötigt.
Damit autonome und hochautomatisierte Zahlungen zwischen Maschinen möglich sind, braucht es digitale Identitäten zur rechtssicheren Authentifikation der Maschinen.
Dem „Internet of Payments“ müssen Standards zu Grunde liegen.
Damit eine solche Lösung eine hohe Marktakzeptanz erreicht, ist im Zuge der europäischen und internationalen Zusammenarbeit (ähnlich wie bei SEPA oder EBICS) die Vereinbarung gemeinsame Standards im Vorfeld notwendig.
Es wird keine „One-Fits-All“-Lösung eines digitalen Euro geben.
Daher sollten Unternehmen von Anfang an aktiv in die Entwicklung eines digitalen Euro miteingebunden werden.Da Unternehmen zudem essenziell zur Förderung der allgemeinen Marktakzeptanz beitragen und über spezifische und komplexe Bedarfe verfügen, kann ein digitaler Euro für Unternehmen als Katalysator für einen Retail-CBDC für Privatnutzer dienen.
Große und kapitalmarktorientierte Unternehmen müssen aufgrund ihrer Ressourcen eine Vorreiterrolle einnehmen.
In Proof of Concepts (PoCs) und Leuchtturmprojekten können sie die Mehrwerte eines digitalen Euro für die gesamte Wirtschaft und insbesondere KMU demonstrieren.
Interoperabilität und Fungibilität sind Grundvoraussetzungen.
Zur Gewährleistung der Kompatibilität unterschiedlicher Lösungen muss bei der Entwicklung eines digitalen Euro die Interoperabilität und Fungibilität stets sichergestellt werden.
EZB als Koordinator und Banken als Dienstleister im Front-End gefragt.
78% der befragten Unternehmensvertreterinnen und -vertreter wünschen sich zur Sicherstellung der Kompatibilität der angestrebten Lösung die Ausgabe eines digitalen Euro durch die EZB. Gleichzeitig sprechen sie sich für den Erhalt der „Zwei-Ebenen-Finanzmarktstruktur“ und für die Innovationskraft des privaten Sektors bei Übergangslösungen aus.
Die Belebung des Zahlungsverkehrsthemas durch den digitalen Euro bietet Beratungschancen für Banken.
Denn die Einschätzung der Zahlungsverkehrsbedarfe von Unternehmensvertreterinnen und -vertreter sowie deren Beraterinnen und Beratern wiesen teils erhebliche Differenzen auf. Für eine fundierte Beratung „auf Augenhöhe“ müssen die Bankberaterinnen und -berater daher dringend weitergebildet werden.
Die Unternehmen wünschen sich eine zügige, aber technisch ausgefeilte Lösung.
43% der befragten Unternehmensvertreter präferieren eine möglichst zeitnahe Einführung eines digitalen Euro, innerhalb der nächsten zwei Jahre. Weitere 43% bevorzugen einen digitalen Euro erst nach sorgfältiger technischer Prüfung in drei bis fünf Jahren.
Um den Anschluss zu anderen Währungsräumen nicht zu verpassen, ist auch in Europa eine geeignete Infrastruktur („Internet of Payments“) zum proaktiven Austesten und Entwickeln neuer, digitaler Zahlungslösungen von Bedeutung.
Dabei ist insbesondere Technologieneutralität essenziell, um vorab keine bestimmte Form eines digitalen Euro zu determinieren und die Innovationskraft privater Akteure sowie eine spätere Marktakzeptanz negativ zu beeinflussen.